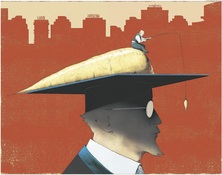 Illustration: Paolo Friz für NZZ am Sonntag
Illustration: Paolo Friz für NZZ am Sonntag
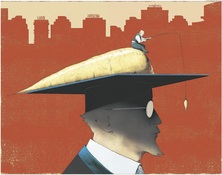 Illustration: Paolo Friz für NZZ am Sonntag Illustration: Paolo Friz für NZZ am Sonntag Vermehrt versuchen Hochschulen, Forschungsresultate auf dem Markt zu verkaufen. Und Wirtschaftsunternehmen sponsern Lehrstühle auf ihrem Themengebiet. Diese neue Orientierung der Hochschulen birgt Chancen und Gefahren: Inwieweit gibt es Interessenkonflikte? Wo sind die Grenzen der Beteiligung von Auftraggebern? Wie wird die Unabhängigkeit der Forschung gesichert? Sind Sponsorverträge offenzulegen? Die Folgen der neuen Finanzierungsmodelle sind noch wenig untersucht, die Debatten beginnen erst.
Das schweizerische Anbaumoratorium für gentechnisch veränderte Pflanzen läuft im November 2013 aus. Die Debatte um eine befristete Verlängerung spaltet auch Wissenschaft und Forschung. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 6. September 2012 Vergangene Woche hat das Nationale Forschungsprogramm 59 (NFP 59), «Chancen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen», in Bern seine Resultate präsentiert. Der Bundesrat hatte das Programm 2005 nach der Volksabstimmung über das Gentech-Moratorium beim Schweizerischen Nationalfonds in Auftrag gegeben; die Resultate kommen rechtzeitig für die Debatte um eine Moratoriumsverlängerung.
Er sprüht vor Optimismus und gilt als der Schweizer Vorzeige-Wissenschaftsfunktionär. Von Risiken spricht Patrick Aebischer, Präsident der ETH Lausanne (EPFL), nicht gern. Ein Porträt. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 26. April 2012
Der Agrarkonzern Syngenta bezahlt zehn Millionen für eine neue Professur an der ETH Zürich – und redet auch bei der Berufung mit. Ist der Konzern an unabhängiger Agrarforschung interessiert? Bisherige Erfahrungen lassen Zweifel aufkommen. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 9. Februar 2012 Meienberg spricht vom Lehrstuhl «Nachhaltige Agrarökosysteme», den die ETH Zürich im Rahmen des neu gegründeten Kompetenzzentrums World Food System dieses Jahr besetzen will. Der Schweizer Agrarkonzern Syngenta finanziert den Lehrstuhl für die ersten zehn Jahre mit zehn Millionen Franken.
Wer die wichtigste Menschheitsfrage beantworten will, braucht einen breiten Wissenschaftsbegriff. Nicht alle finden das gut. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 24. April 2008 Manchmal verbergen sich Geschichten hinter einem einzelnen Buchstaben. Das Gremium aus über vierhundert WissenschaftlerInnen, das am 15. April seinen bahnbrechenden Bericht zur Weltlandwirtschaft präsentiert hat - bahnbrechend, falls er ernst genommen wird - , ist zuständig für die «Internationale Bewertung von landwirtschaftlichem Wissen, Wissenschaft und Technik für die Entwicklung», englisch International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development. Das Akronym dazu, das auch für das Gremium steht, heisst IAASTD - ohne «K» für «Knowledge». Die Geschichte dieses «K» spiegelt, was den Bericht so aussergewöhnlich macht - und wofür er gescholten wird.
Das Bundesamt für Umwelt bewilligt die Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen, die noch gar nicht existieren. Das verstosse gegen das Gesetz, meint Greenpeace. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 4. Oktober 2007 Am 3. September [2007] hat das Bundesamt für Umwelt (Bafu) drei wissenschaftliche Experimente mit gentechnisch verändertem Weizen im freien Feld bewilligt. Es handelt sich um Versuche der ETH und der Universität Zürich, die den Kern des Nationalen Forschungsprogramms 59 (NFP 59) zu «Chancen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen» bilden (siehe WOZ Nr. 23/07).
Vergangene Woche hat Greenpeace, zusammen mit anderen Umwelt- und Bauernorganisationen, das Bafu aufgefordert, den Entscheid rückgängig zu machen, da er gegen das Gentechnikgesetz verstosse. Das Nationale Forschungsprogramm 59 hätte das Freisetzungs-Moratorium nutzen können, um Risiken zu evaluieren. Aber das war wohl gar nie erwünscht. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 23. November 2006 Die Weichen für die offizielle Schweizer Biosicherheitsforschung der nächsten Jahre sind gestellt. Ende Oktober entschied die Leitung des Nationalen Forschungsprogramms 59 «Chancen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen» (NFP 59), wer zur Einreichung eines Projektantrags eingeladen wird.  Foto: ETH Zürich Foto: ETH Zürich Präsident Ernst Hafen will die ETH zur «weltbesten naturwissenschaftlich-technischen Universität» machen. Bis jetzt hat er vor allem seine Untergebenen verärgert. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 28. September 2006 Gut fünf Wochen nach Erscheinen dieses Portraits in der WOZ trat Ernst Hafen unter Druck der Professorenschaft als Präsident der ETH Zürich zurück. Dieses Portrait war der einzige kritische Text über Ernst Hafen in der Schweizer Presse bis unmittelbar vor Hafens Rücktritt. Der Text wurde 2007 mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichnet. Von einer angekündigten Revolution soll die Rede sein und von ihrem Revolutionär. Sowie von der dereinst «besten naturwissenschaftlich-technischen Hochschule der Welt». Zuerst aber ein bescheidenerer Superlativ: Die bekannteste Angehörige der ETH Zürich war diesen Winter Daniela Meuli. Die Sportstudentin gewann in Turin olympisches Gold. Ernst Hafen, ETH-Präsident seit dem 1. Dezember 2005, nannte in einer Rede anlässlich der ersten hundert Tage im Amt drei Punkte, die ihm gezeigt hätten, dass seine Schule top sei. Der dritte Punkt war Meulis Gold. «Es liegt in der Natur des Menschen, dass er immer vergleicht, und auch die Unis werden verglichen. So problematisch Ranglisten sein können, sie spielen in der Visibilität der Hochschule eine wichtige Rolle. Der Vergleich mit dem Sport liegt da natürlich auf der Hand.» Ein kleines Forschungsinstitut kämpft gegen die Macht der Agrokonzerne – mit den Waffen der ComputeranarchistInnen. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 21. September 2006 Die Computerwelt kannte von Anfang an Leute, die ihr ambivalent gegenüber standen: begeistert von den Möglichkeiten der Informationstechnologie, aber skeptisch, was ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft angeht. In der Gentechnologie, namentlich der Agrargentechnologie, hingegen sind ambivalente Töne kaum zu hören. Denn diese ist politisch umkämpft, und politische Debatten werden nicht mit «Ja, aber» und «Nein, aber» geführt. Allenfalls hinter vorgehaltener Hand erfährt man, wenn ein Befürworter auch Bedenken hegt, eine Gegnerin auch Chancen sieht.
Da horcht man auf, wenn einer, der vom Segen der Biotechnologie überzeugt ist, den Agrokonzernen an den Karren fährt und sie des «‹Kidnappings› der öffentlichen Wissenschaft» bezichtigt. Gemeint ist die Praxis, Entdeckungen wie etwa Genomsequenzen als «Erfindungen» zu patentieren und als Eigentum zu vermarkten: «Wir sind zutiefst überzeugt, dass die patentgeschützte monopolistische Kontrolle fundamentaler Prozesse des Lebens absolut inakzeptabel ist.» Alle reden von Drittmitteln und Technologietransfer, niemand untersucht die Folgen. Dabei droht der Ausverkauf der unabhängigen, öffentlichen Wissenschaft. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 15. Dezember 2005 Jörg Schüpbach ist Leiter des Nationalen Zentrums für Retroviren (NZR), Jürg Böni sein Stellvertreter. Dieses Institut des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) entwickelte 1992 ein Verfahren namens Pert zum Nachweis unbekannter Viren. Vermarktet wird Pert von der dafür gegründeten Firma TPC-The PERT Company in Wettingen. Die Firma gehört Jörg Schüpbach und Jürg Böni.
Ein kleines Beispiel für gelungenen Technologietransfer. Schüpbach und Böni initiierten die Patentierung des von ihnen erfundenen Verfahrens und kauften dem Bund als Betreiber des NZR das Patent ab, indem sie Entwicklungs- und Patentierungskosten zurückerstatteten. Aber das Beispiel ist nicht unproblematisch: Wenn Schüpbach und Böni das Verfahren in Fachartikeln preisen, sprechen sie dann als Wissenschaftler - oder als Unternehmer, die ihr Produkt verkaufen wollen? Rezension von Marcia Angell: Der Pharmabluff. Wie innovativ die Pillenindustrie wirklich ist, Bonn/Bad Homburg 2005 – Der gewichtigste Angriff auf die Pharmaindustrie erfolgt aus dem Zentrum des medizinischen Establishments heraus. – «WOZ Die Wochenzeitung» vom 30. Juni 2005 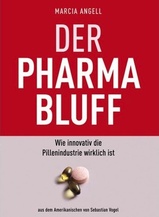 Ist «Big Pharma» innovativ? Kaum. Sind neue Medikamente gut? Selten. Sind die Medikamentenpreise gerechtfertigt? Nein. Belügen die Pharmafirmen die KonsumentInnen? Ja. Korrumpiert die 500-Milliarden-Franken-Industrie am Ende gar Politik, Wissenschaft, ÄrztInnen? Und wie. Wenn eine Buchautorin solche Verdikte über eine ganze Branche fällt, muss sie entweder eine durchgeknallte Wirtschaftshasserin sein. Oder es muss mit dieser Branche sehr viel im Argen liegen. Marcia Angell, von deren Buch «Der Pharma-Bluff» hier die Rede ist, ist ganz bestimmt nicht Ersteres, sondern eine der renommiertesten Stimmen im medizinischen Wissenschaftsbetrieb: Sie war jahrelang die Chefredaktorin des «New England Journal of Medicine», der einflussreichsten Wissenschaftszeitschrift der Welt. Wenn ihr Wörter wie «räuberisch» oder «Erpressung» aus der Feder fliessen, so basiert ihr Urteil auf jahrelanger Erfahrung. |
AutorMarcel Hänggi, Zürich Themen
Alle
|


