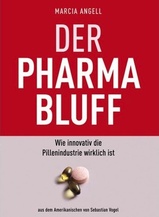
Wenn eine Buchautorin solche Verdikte über eine ganze Branche fällt, muss sie entweder eine durchgeknallte Wirtschaftshasserin sein. Oder es muss mit dieser Branche sehr viel im Argen liegen. Marcia Angell, von deren Buch «Der Pharma-Bluff» hier die Rede ist, ist ganz bestimmt nicht Ersteres, sondern eine der renommiertesten Stimmen im medizinischen Wissenschaftsbetrieb: Sie war jahrelang die Chefredaktorin des «New England Journal of Medicine», der einflussreichsten Wissenschaftszeitschrift der Welt. Wenn ihr Wörter wie «räuberisch» oder «Erpressung» aus der Feder fliessen, so basiert ihr Urteil auf jahrelanger Erfahrung.
Alter Wein in neuen Schläuchen
Oder zum Beispiel Nexium, ein so genannter Protonenpumpehemmer gegen Sodbrennen. 2001 lief ein Patent auf den Protonenpumpehemmer Prilosec von AstraZeneca aus. Prilosec war mit 7,5 Milliarden Franken Jahresumsatz eines der umsatzstärksten Medikamente überhaupt. Just im selben Jahr patentierte AstraZeneca Nexium. Dieses enthält einen Teil der Inhaltsstoffe von Prilosec - Angell nennt es ein «Halb-Prilosec». Obwohl in Nexium nichts drin ist, das nicht schon in Prilosec enthalten war, erhielt AstraZeneca ein neues Patent. AstraZeneca hatte also nichts wirklich Neues entwickelt, investierte aber 2001 eine halbe Milliarde US-Dollar, um diesen alten Wein in neuen Schläuchen zu vermarkten. Die Strategie ging auf: Obwohl heute billige Prilosec-Generika zu haben wären, verlangen PatientInnen und verschreiben ÄrztInnen vorwiegend das teure, patentgeschützte Nexium.
Man könnte argumentieren, das sei legitimes Verhalten gewinnorientierter Unternehmen in einer freien Marktwirtschaft, und wenn die KonsumentInnen lieber das teurere Medikament haben wollten, sollten sie es haben. Ein solches Argument geriete aber von zwei Seiten her in Bedrängnis: Erstens wollen die Firmen selber nicht als rein kapitalistische Gewinnmaschinen wahrgenommen werden. Lieber stellen sie sich als Wohltäterinnen dar - schliesslich verkaufen sie Medikamente, die Leben retten können. Deshalb behaupten deren PR-Abteilungen, die Firmen würden Gutes tun, die Medizin voranbringen, in die Aus- und Weiterbildung von ÄrztInnen investieren und die Bevölkerung aufklären.
Zweitens kann von freier Marktwirtschaft keine Rede sein. Big Pharma ist eine risikofreie, steuerbegünstigte Branche, die ihre Profite im Wesentlichen unter Patentschutz erwirtschaftet. Sowohl das Patentrecht wie die Praxis der Patentgewährung wurden seit 1980 immer wieder den Interessen der Pharmaindustrie angepasst. Diese unterhält beispielsweise in Washington 675 LobbyistInnen - mehr, als der Kongress Mitglieder hat. Innovative (und risikoreiche) Forschung betreiben in erster Linie öffentliche Institutionen mit Geldern der öffentlichen Hand; die Industrie erwirbt Rechte an den Forschungsresultaten zu Spottpreisen. So zahlen die KonsumentInnen zweimal: Zuerst finanzieren sie über die Steuern die zugrunde liegende Forschung, danach zahlen sie die überhöhten Preise. Dabei zahlen sie deutlich mehr an die Unternehmensgewinne und das Marketing als an Forschung und Entwicklung.
«Weiterbildung» als Marketing
Die Forschung, die die Industrie selber leisten muss, sind die klinischen Tests. Häufig werden diese an eigens dafür gegründete Forschungsfirmen oder an Universitäten in Auftrag gegeben; von Unabhängigkeit kann nicht die Rede sein.
Das Geld, das die Pharmaindustrie laut Marcia Angell für Weiterbildung ausgibt, ist im Wesentlichen eine Mischung von Marketing und Bestechung: Man müsste einigermassen naiv sein zu glauben, ein Seminar an einem schönen Wintersportort, das den ÄrztInnen gratis offeriert wird und nebst einigen Vorträgen viel Freizeit und Skiliftkarten bietet, verfolge einen anderen Zweck. Der Einfluss der Pharmaunternehmen auf die öffentliche Meinung und Wissenschaft ist so stark, dass es ihr gelingt, Definitionen von Krankheit zu verändern, sodass mehr Leute als krank gelten, und gar neue Krankheiten zu erfinden (etwa die «erektile Dysfunktion», eine Erfindung des Viagra-Herstellers Pfizer). Das «British Medical Journal» hat deshalb 2002 eine Liste der Nichtkrankheiten erstellt.
Nun betrifft einiges in Angells Buch die spezifische Situation in den USA, wo die Medikamentenpreise - anders als in den restlichen Industriestaaten ausser Neuseeland - von den Firmen beliebig festgesetzt werden können. Das meiste lässt sich aber auf Europa übertragen. Die Firmen sind dieselben.
In der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) und in der ÄrztInnenvereinigung FMH wird das Verhältnis von ÄrztInnenschaft und Industrie seit längerem diskutiert; die SAMW hat im vergangenen Dezember entsprechende Richtlinien erlassen.
Rund achtzig Prozent der medizinischen Forschung in der Schweiz werden privat finanziert - Unabhängigkeit darf unter solchen Voraussetzungen niemand erwarten.
In Britannien, das eine ähnliche Medikamentenpreisbildung kennt wie die Schweiz, hat eine parlamentarische Untersuchungskommission einen Bericht über den Einfluss der Pharmaindustrie verfasst, der zu ähnlich düsteren Resultaten kommt wie Angell in ihrem Buch.
Marcel Hänggi