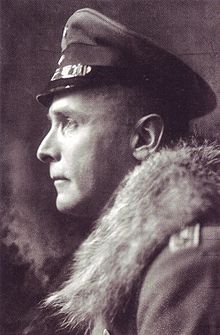| Es war einer dieser Zufälle, die Bücher miteinander ins Gespräch bringen. Eben hatte ich «Das Mittelalter hört nicht auf» von Valentin Groebner gelesen – jenen Essay, in dem der Luzerner Mediävist nachzeichnet, wie das Mittelalter seit der Erfindung des Begriffs fortwährend neu erfunden und benutzt wird –, als ich in meiner allabendlichen Lektüre im Tagebuch von Harry Graf Kessler den Eintrag vom 20. Oktober 1915 las: «[General] Gerok sprach bei Tisch über einen Artikel von Belz in der ‹Tat›, der die Rezeption der Renaissance und des Humanismus für das Verhängnis der deutschen Kultur erklärt. Gerok scheint diese Anschauung zu teilen. Ich sagte, ohne Humanismus hätten wir weder Goethe noch Schiller gehabt, auch sei die deutsche Kultur, die der Humanismus und die Renaissance im 16ten Jh. zerstört hatten, schon von selber im Absterben, überlebt unfruchtbar gewesen.» |
«Kessler ist ja schon eine Fundgrube», schrieb mir Groebner, als ich ihn auf die Stelle aufmerksam machte. O ja: Graf Kessler (1868-1937), war ein Tagebuch-Maniac; ein Zeitzeuge, wie man ihn sich besser nicht wünschen kann: brillant formulierend, nach fast allen Seiten interessiert, mit einem unglaublichen Kontaktnetz, ohne Berührungsängste gegen alle Bevölkerungsschichten und Weltanschauungen. Dabei meist aus einer gewissen, oft ironischen Distanz seine Zeit beobachtend, etwa am Dreikönigstag 1919, mitten in den Berliner Revolutionswirren, als die kommunistischen SpartakistInnen gegen die sozialdemokratische Regierung kämpften:
«(…) zwei Demonstrationen ziehen aneinander vorüber (…); beide bestehen aus den gleichen, genau gleich gekleideten grauen Kleinbürgern und Fabrikmädchen, schwingen dieselben roten Fahnen, marschieren den gleichen Familien Marschtritt. Nur tragen sie verschiedene Inschriften, höhnen einander im Vorbeiziehen und werden heute noch vielleicht auf einander schiessen. (…) Nie seit den grossen Tagen der Französischen Revolution hat soviel bei den Strassenkämpfen in Einer Stadt für die Menschheit auf dem Spiel gestanden.»
Seit bald drei Jahren verbringe ich fast allabendlich meine Viertel- bis Halbstunde mit dem Grafen, und für mindestens zwei weitere Jahre dürfte ich ihm treu bleiben. 1880, im Alter von zwölf, verfasste er seinen ersten Eintrag, am 30. September 1937, dem Tag seines Todes, den letzten. 16 000 Seiten sind das, gegen 9000 eng bedruckte Seiten werden es in der Buchausgabe sein, die derzeit im Marburger Literaturarchiv entsteht. 6000 davon, Ende 1891 bis Anfang 1919, habe ich hinter mir, die wilden Zwanziger und die Emigration nach Hitlers Machtergreifung liegen vor mir.
Kessler war Kosmopolit par excellence, Prototyp des Intellektuellen in einem globalisierten Europa, das sich 1914 so unfassbar schnell ins Verderben stürzte. Sohn eines schweizerisch-deutschen Grafen und einer irisch-englischen Mutter – Musikerin, Schauspielerin, Schriftstellerin und angebliche ehemalige Geliebte Wilhelms I.; Enkel eines anglo-indischen Marineoffiziers; aufgewachsen in London und Paris, perfekt englisch-, französisch- und deutschsprachig (zudem spricht er Italienisch, Spanisch, liest Latein und Griechisch). Er, der nie für Geld arbeiten musste (der Börsencrash 1929 ruinierte ihn, doch unterhielt ihn von nun an seine Schwester), verbrachte den grössten Teil seiner Lebenszeit damit, mit interessanten Menschen zu frühstücken und zu dinieren, Fäden zu ziehen, Projekte anzureissen, die oft im Sand verliefen. Und alles schrieb er nieder.
Ich hatte durch Schlögel und den niederländischen Journalisten und Historiker Geert Mak («In Europa») erstmals von Kessler gehört – und subskribierte, ohne eine Seite gelesen zu haben, gleich die ganze, auf neun Bände angelegte Tagebuchedition. Ich entschloss mich, auf diese Reise zu gehen, ohne zu wissen, was auf mich zukommt.
Mit einer Reise begann die Lektüre des zweiten Bandes (Band 1 ist noch nicht erschienen). Kessler reist von Ende 1891 bis Mitte 1892 um die Welt – USA, Japan, China, Vietnam, Singapur, Malaysia, Indien, Aden, Ägypten, Italien. Bis zum Ende des zweiten Bandes, 1897, unternimmt er eine Kunstreise nach Norditalien, pendelt dauernd zwischen Deutschland, Frankreich und England, leistet Militärdienst (für Angehörige seines Standes eine angenehme Sache mit viel Offiziersdiners, Ausritten und homoerotischen Badeeskapaden) und reist noch einmal in die USA sowie nach Kanada und Mexiko, wo er den Popocatépetl besteigt:
«Die Luft ist kalt und klar und dünn. Und nun will die Sonne aufgehen. Das Weltenweihefest beginnt. In den Thälern regt sichs und vom Nebelmeer lösen sich Wolkenzüge und schweben an Abgründen aufwärts; aus den östlichen Tiefen brechen weissflimmernde Strahlen hervor und stehen am Himmel als Pfande des Lichts; Himmel und Erde sind künftige Farbe, schweigendes Werden.»
(15. November 1896)
«Einige prachtvolle Kämpfe (…). Namentlich als ein schöner, schlanker Kerl von etwa 25 Namens Charley Knock, der klassisch und knapp wie eine griechische Bronze gebaut war, eine Art von schwerem Riesen besinnungslos hinstreckte, ‹knocked out›. (…) Der schwere Riese stand hin und her torkelnd zwei oder dreimal wieder auf und holte zum Boxen aus; aber der Andre streckte ihn, fast ohne die Beine oder den Leib zu rühren, blos die Faust gradeaus schnellend jedesmal mit einem Schlag krumm hin. Etwas Schöneres habe ich kaum gesehen. (…) East End und Griechenland in eins gemischt, und ohne eigentlichen Kontrast. Im Gegenteil.»
(25. April 1903)
«Neue Films von der Sommeschlacht in der vordersten Linie aufgenommen; Sturmangriffe, Flammenwerfer, Gaswolken. Szenen von grosser wilder Schönheit. Die neue deutsche Sturmhaube wirkt fast antik.»
(31. Oktober 1916)
«Das Leichenbegängnis der Matrosen war über Erwarten grossartig. (…) Der ganze gewaltige Raum, unregelmässig eingerahmt von strengen, prunkvollen Gebäuden, vielleicht der ernsteste und schönste grosse Platz der Welt, wurde durch diese unabsehbare, gewaltige, überall gleichartig grauschwarze Proletariermenge zu einer Einheit.»
(29. Dezember 1918)
«Niemand anders in Deutschland hat eine so starke, nach so vielen Seiten reichende Stellung. Diese ausnutzen im Dienste einer Erneuerung Deutscher Kultur: mirage oder Möglichkeit? Sicherlich könnte Einer mit solchen Mitteln Princeps Juventutis sein. Lohnt es der Mühe?»
(15. November 1905)
Diese Wandlungen der Zeit ereigneten sich in harten Brüchen. Kessler hat sie mitgemacht, als wollte er sie möglichst auskosten: vom Aristokraten zum Kommunisten, vom Weltbürger zum Nationalisten, vom Kriegsverherrlicher zum Pazifisten. Die Zeit vor dem Krieg, «Europas glanzvollste Zeit» (Schlögel), verbringt Kessler als Reisender in Sachen Kunst. Er plant (mit Henry van de Velde) ein Nietzsche-Denkmal, gründet seine Cranach-Presse, um eine bibliophile Homer-Ausgabe herauszugeben – wozu er eigens ein Papier schöpfen lässt, das seinen Erwartungen entspricht –, unterstützt junge Künstler. Der Versuch, seine Freunde Maillol und Hugo von Hofmannsthal auf einer gemeinsamen Reise mit dem Genius loci Griechenlands bekannt zu machen, gerät zur Tragikomödie – die beiden Künstler können sich nicht leiden und sprechen kein Wort miteinander; Hofmannsthal versinkt in Heimweh, während Kessler und Maillol am Strand den einheimischen Jungen beim Nacktbaden zusehen. Für den russischen Ballettimpresario Sergej Diaghilew und seinen schönen Tänzer Nijinski schreibt Kessler gemeinsam mit Hofmannsthal die «Josephslegende» (Musik: Richard Strauss). Er verkehrt mit dem suizidgefährdeten kommunistischen Schriftsteller Johannes R. Becher (dem späteren DDR-Nationaldichter) und mit dem protofaschistischen Ekel Gabriele D’Annunzio, der sich selber als grössten Dichter seit Dante sieht und vom sicheren Paris aus seine italienische Regierung attackiert, weil sie in ihrem Krieg in Libyen nicht aggressiv genug agierte. Auch wenn die zunehmenden politischen Spannungen im Hintergrund ständig präsent sind und sich auch in seinen Tagebüchern die nationalen Stereotypen häufen, bleibt Kessler der Kosmopolit, bis er – in Paris – vom Kriegsausbruch überrascht wird. Er reist nach Deutschland und rückt ein, zunächst gegen das neutrale Belgien. Und nun wird die Lektüre erschütternd: Wie ein Reporter schildert er eindringlich die deutschen Kriegsverbrechen – und legitimiert sie gleichzeitig.
«Jedenfalls hat man das Recht, solche furchtbaren Exekutionen wie die in den Ardennen auszuführen, wenn sich unsere Leute tadellos verhalten; das ist die Gegenleistung, die der Feind von uns erwarten kann. (…) Man muss wohl bis auf den 30 jährigen Krieg zurückgehen, um Etwas Ähnliches wie das schauerliche Drama in Seilles Ardenne zu finden.»
(22. August 1914)
Später gelangt Kessler an die Ostfront, kämpft sich durch die winterlichen Karpaten. Er bleibt der kritische Beobachter, der sich entsetzt, wenn die Generäle für ihre Fronthauptquartiere weisse Tischtücher beschlagnahmen lassen – und träumt von einem deutschen Reich von Riga bis Johannesburg. Als ein Vorgesetzter ihm aufträgt, die Geschichte der Schlacht an der Styr zu schreiben, spricht er mit Soldaten in den Schützengräben und russischen Kriegsgefangenen, und wenn er auch letztlich scheitert, sind seine Tagebucheinträge aus dieser Zeit doch mikrohistorische Präziosen, in denen der Offizier Kessler den Krieg mit den Augen des einfachen Soldaten betrachtet – und beispielsweise, neben allen Grausamkeiten, Verbrüderungsszenen zwischen Soldaten beider Seiten schildert, die kein Interesse daran haben, sich gegenseitig umzubringen.
Die letzten beiden Kriegsjahre verbringt Kessler als Kulturattaché – Propagandachef – in der deutschen Botschaft in Bern, unternimmt eigene Vermittlungsanstrengungen und schwankt immer stärker zwischen Kriegspathos und zunehmender Abscheu. Als er am 2. November 1917 zu Rainer Maria Rilke sagt, «man könne den Krieg als Ganzes verdammen, für unsinnig und tierisch erklären, in seinen Details, in einzelnen Momenten berge er seelische Schönheiten und Offenbarungen, die nur mit denen der Liebe zu vergleichen seien», so ist da neben der Ästhetisierung auch der Zweifel schon vorhanden. Am 27. Juli 1918 hält er, mit einem seiner raren Ausrufezeichen, gegen seine früheren Überzeugungen fest:
«Der Krieg ist keine Läuterung!»
Ab August 1918 bricht die deutsche Stellung zusammen. Als Kessler am 4. Oktober von der deutschen Kapitulation erfährt, denkt er an Selbstmord – und doch zeichnet sich schon seine Utopie für die Nachkriegszeit ab:
«Als ich (…) Nachts um eins über die Brücke gieng, hatte ich Lust, in die Aare zu fallen. Ich war vielleicht innerlich nur zu tot, um es zu tun. Denn nur wenn in der Tat das Ideal ersteht, der freie Bund von lauter freien, gleichberechtigten, friedlichen Völkern, sind diese Tage nicht des Deutschen Volkes Untergang. Wird das Tausendjährige Reich morgen Wirklichkeit?»
«Was man bisher von der Revolution sieht: es wird getanzt, gegründet und von Zeit zu Zeit massacriert.»
(18. Februar 1919)
«Wenn in diese zur Disziplin vorgebildeten deutschen Massen ein Glaube hineinschiesst, Liebknecht oder ein andrer, dann wehe allen Gegnern; wenn nicht heute, so nach einer Generation!»
(7. März 1919)
«Mit Christian nach Marvejols, um mein Herz röntgen zu lassen. (…) Das Städtchen, altmodisch, malerisch, erinnert im Stil und Atmosphäre an Weimar, aber schon fast südlich.»