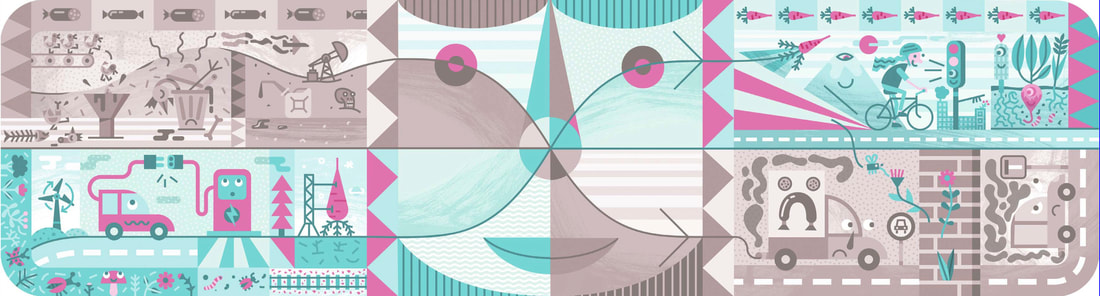«System Change, not Climate Change!» ist ein Slogan an Klimademos, und soeben hat der Klimastreik in einem dreissigseitigen Positionspapier dargelegt, was er unter «System Change» versteht. Konservative Publizist:innen werfen dem Klimastreik vor, die Sorge ums Klima sei nur ein Vorwand; in Wirklichkeit seien die Klimastreikenden, nun, «Systemveränderer».
Aber was ist ein System überhaupt; was eine Systemtransformation?
Der IPCC erklärt in seinem Glossar Begriffe wie «Klimasystem», «Ökosystem» oder «sozial-ökologisches System», nicht aber «System» oder «systemisch». Eine «Transformation» ist laut Glossar eine «Veränderung der grundlegenden Eigenschaften von Systemen».
Um dem Begriff näher zu kommen, lese ich mich quer über die 3000 Seiten des IPCC-Bericht, vergleiche ihn mit dem letzten, fünften Sachstandsbericht von 2014, den ich seinerzeit für die WOZ kritisch begutachtet habe, spreche mit einer Autorin und zwei Autoren des IPCC sowie mit einer Klimastreikerin und einem Historiker.
Systeme, Rückkoppelungen, Kipppunkte
Julia Steinberger ist Professorin der Uni Lausanne und Autorin des IPCC-Berichts. Sie sagt, ein System im wissenschaftlichen Sinne werde gebildet von mehreren Elementen, die miteinander wechselwirkten. Dabei komme es zu komplexem Systemverhalten, das sich nicht verstehen lasse, wenn man nur die einzelnen Elemente betrachte (vgl. Interview weiter unten auf dieser Seite). Andreas Fischlin ist Vizepräsident der zweiten IPCC-Arbeitsgruppe (die sich mit den Auswirkungen der Erwärmung befasst) und Systemökologe. Er versteht den Systembegriff wie Steinberger, meint aber, es sei unklar, ab wann statt von einer blossen Veränderung eines Systems von einem «Systemübergang» zu sprechen sei.
Es gibt eine ganze Systemtheorie mit einer eigenen Begrifflichkeit. Sie ist hier nicht nötig, um zu verstehen, was für Systemänderungen es braucht, um die Klimaerhitzung zu bewältigen, und es wäre schon viel gewonnen, wenn die Klimapolitik verstünde, dass Systeme immer mehrere Dimensionen haben: technische, soziale, kulturelle, ökologische, ökonomische, politische … (vgl. Box weiter unten auf dieser Seite).
Aber ein bisschen Theorie muss sein: Entscheidend für die Komplexität von Systemen sind Rückkoppelungen – eine Wirkung wirkt auf ihre eigene Ursache zurück. Simples Beispiel: Viele Hasen bieten Füchsen viel Nahrung, so dass die Füchse sich vermehren. Mehr Füchse fressen aber mehr Hasen, so dass deren Bestand abnimmt. Nun finden die Füchse nicht mehr genug Nahrung und werden ihrerseits weniger, worauf sich die Hasenpopulation wieder erholt – und so weiter.Eine solche Rückkoppelung heisst negativ. Sie stabilisiert das System: Hasen- und Fuchspopulation pendeln um ein Gleichgewicht.
Positive Rückkoppelungen hingegen eskalieren. Solche Effekte sind im Klimasystem zahlreich. Ein Beispiel: Die Erwärmung lässt Meereis schmelzen, das dunkle Wasser absorbiert mehr Sonnenstrahlung als die helle Eisfläche, erwärmt sich dadurch weiter und bringt noch mehr Eis zum Schmelzen.
Würde es nun wieder kälter, nähme die Eisfläche wieder zu: Der Effekt würde umgekehrt. Das gilt aber nicht für alle Rückkoppelungen: Wenn die Erwärmung gefrorene Böden auftaut, in denen riesige Mengen Kohlenstoff gebunden sind, gelangt dieser Kohlenstoff in die Atmosphäre, wo er als Treibhausgas zur weiteren Erwärmung beiträgt. Würde es nun wieder kälter, kehrte der Kohlenstoff nicht mehr in den Boden zurück.
Solche unumkehrbare Effekte sind äusserst gefährlich. Man spricht in der Ökologie von «Kipppunkten»: Sind sie überschritten, kollabiert das Gleichgewicht. Langfristig wird sich ein neues Systemgleichgewicht einstellen – mit dem die menschliche Zivilisation aber möglicherweise nicht zurechtkommt. Wo genau die Kipppunkte sind, ist schwer zu sagen. Weil Systeme langsam reagieren, ist es möglich, dass man sie überschreitet, ohne es sofort zu bemerken.
Würde statt Wachstum
Positive Rückkoppelungen sind aber nicht unbedingt schlecht: Sie können auch einen erwünschten Wandel beschleunigen. Der IPCC-Bericht nennt etwa Beispiele aus dem Bereich des Verkehrs: Beginnt man, das Velofahren ernsthaft zu fördern, gibt es mehr Velos auf den Strassen. Dadurch werden sie sichtbarer; Automobilist:innen passen ihr Verhalten an und das Velofahren wird weniger gefährlich. Politik und Verkehrsplanung nehmen Velos ernster. Velofahren wird auch in Kreisen chic, in denen es bisher verpönt war. Alle diese Faktoren machen das Velofahren attraktiver, so dass die Zahl der Velofahrer:innen weiter zunimmt.
Und umgekehrt können negative Rückkoppelungen unerwünschte Techniken stabilisieren, auch wenn es längst bessere Alternativen gibt – beispielsweise, weil es Interessengruppen gibt, die eine Technik am Leben erhalten wollen, oder wegen schierer Gewohnheit. Die Vorstellung, dass sich auf dem Markt immer aus eigener Kraft die bessere Technik durchsetzt, ist naiv.
Anthony Patt, Professor für Klimapolitik an der ETH Zürich und Koordinierender Hauptautor des jüngsten IPCC-Berichts, erforscht solche Dynamiken technischen Wandels. Ich habe mit ihm seinerzeit über den IPCC-Bericht von 2014, den AR5, gesprochen. Damals sagte er: «Ich war als Nicht-Ökonom ein Aussenseiter in meiner Arbeitsgruppe. Die Autorenkollektive fast aller Kapitel wurden von neoklassischen Ökonom:innen geleitet. Es war frustrierend.»
Diesmal ist Patt zufrieden. Und tatsächlich ist der Unterschied gross. Der AR5 wies «Kosten» klimapolitischer Massnahmen in der Einheit «Reduktion des Konsumwachstums» aus – wodurch er maximales Konsumwachstum als Ideal setzte. Der aktuelle Bericht AR6 hingegen befasst sich ausführlich damit, wie ein «würdevolles Leben» (decent living) mit weniger Konsum möglich ist und stellt fest, dass eine Senkung des Energieverbrauchs oft mit einer Verbesserung der Lebensqualität einher geht.
Obwohl seit dem Erscheinen des AR5 weitere acht Jahre mit steigenden Emissionen vergangen sind, ist der AR6 optimistischer als sein Vorgängerbericht. Damals, sagt Patt, sei er ziemlich einsam gewesen mit seinem Glauben, dass es möglich sei, die Emissionen bis 2050 weltweit auf netto null zu senken. Laut dem AR5 war es zwar theoretisch möglich, aber unrealistisch, die Erwärmung auf 2 Grad zu begrenzen – von 1,5 Grad war noch gar nicht die Rede.
Dass der neue Bericht optimistischer ist, hat einerseits damit zu tun, dass die nötigen Techniken wie Solarpanels oder Batterien sehr viel billiger geworden sind. Es hat aber auch damit zu tun, dass die Wissenschaft heute anders – systemischer – auf die Gesellschaft blickt. «Solange man Erfahrungswerte aus der Vergangenheit in Modellrechnungen in die Zukunft extrapoliert», sagt Patt, «ist es ziemlich hoffnungslos. Aber wenn man daran glaubt, dass sich Systemeals Systeme verändern können, ist viel mehr möglich.» Solchen Wandel zu modellieren sei indes sehr schwierig, weil man nicht ein Element eines Systems ändern könne, ohne dass sich auch die anderen Elemente veränderten. «Aberheute können wir sehen, dass solche Prozesse tatsächlich stattgefunden haben.»
Und so lautet denn die wichtigste Aussage des aktuellsten Berichts: Es ist möglich – es muss jetzt nur alles sehr viel schneller gehen.
System Change oder CO2-Preis
Das sind gute Neuigkeiten. Sie müssten nur gehört werden. Und da wird es schwierig. «Wir haben eine Kultur, die sich schwer tut mit dem Systemdenken», sagt Systemökologe Fischlin: «Nicht viele Leute verstehen das.»
Der Historiker Jakob Tanner hat sich intensiv mit der Geschichte des Systembegriffs befasst. Er verweist auf die Bedeutung von Rückkoppelungen in der Ökonomie. Die dominierende Schule der Wirtschaftswissenschaften – eben jene Neoklassik, die noch den letzten IPCC-Bericht dominierte – ist eine Gleichgewichtstheorie: So, wie Fuchs- und Hasenpopulationen sich um ein Gleichgewicht einpendeln, tun es auf dem Markt Angebot und Nachfrage. Die Wirtschaft stabilisiert sich selbst. Mit positiven Rückkoppelungen, die beispielsweise zu Spekulationsblasen führen oder Ungleichheiten verstärken, kann die neoklassische Wirtschaftstheorie schlecht umgehen.
«Die Neoklassik sieht vor allem die negativen Rückkoppelungen und hält eine Systemveränderung für unnötig. Ihre Klimapolitik setzt auf den Marktmechanismus und einen CO2-Preis», sagt Tanner. «Doch wenn man positive Rückkoppelungen im Auge behält, die Fehlentwicklungen verstärken und auf katastrophale Kipppunkte zusteuern könnte, dann wird man auch Vorschriften und Verbote in Erwägung ziehen.»
Auf die Spitze getrieben hat das Denken in negativen Rückkoppelungen der Neoliberalismus. Der neoliberaleVordenker Friedrich Hayek sah im Markt eine Informationsverarbeitungsmaschine, in der alle Signale zusammenlaufen und über die sich das System Wirtschaft reguliert – sofern man dem Markt freies Spiel lässt. Menschen und menschliche Institutionen hingegen könnten nie genug wissen. Jeder Versuch, die Wirtschaft (oder die Gesellschaft) bewusst in eine bestimmte Richtung zu lenken, sei eine «Anmassung von Wissen». Wer so denkt, dem muss die Forderung nach «Systemumbau» ein Gräuel sein. Und wer nicht «Systeme», sondern «das System» verändern will, sowieso.
Letzteres will der Klimastreik. Annika Lutzke, die in der Arbeitsgruppe System Change des Klimastreiks mitwirkt, sagt: «Wir verstehen unter ‹System› das ökonomische System: seinen Wachstumszwang, die Eigentumsverhältnisse, wie die Arbeit organisiert ist. Dieses System liegt den wichtigen Entscheidungen zugrunde.» Es gehe darum, zu diskutieren, was die Grundbedürfnisse seien und wie sie mit wenig Ressourcenverbrauch gedeckt werden könnten. Diese Frage müsse demokratisch verhandelt werden: «Wir Klimastreikenden studieren mehrheitlich, sind jung, weiss, privilegiert. Wir sind nicht repräsentativ. Die Fragen, die wir aufwerfen, müssen von allem gemeinsam beantwortet werden. Mit unserer Arbeit wollen wir aufzeigen, dass es eine Systemveränderung braucht und dass diese für das Leben der Menschen gut ist.»
Wie sich Grundbedürfnisse mit wenig Ressourcenverbrauch decken lassen: Die Frage passt zum Konzept des «würdevollen Lebens», das der IPCC aufgenommen hat. Auch dass ein suffizienter Systemumbau das Leben verbessern kann, stützt der IPCC-Bericht. Meinen der Klimastreik und der vom IPCC zusammengefasste wissenschaftliche Konsens letztlich das selbe? Muss «systems transformation» so gross gedacht werden, wie es der Klimastreik tut?
«Ha!», sagt Anthony Patt, als ich ihn darauf anspreche: «Das ist die grosse Frage! Und wir waren uns nicht einig.» In einer Arbeitsgruppe, die Patt leitete, habe man diese Frage diskutiert. «Ein Drittel von uns verstand unter ‹Systemwandel›, Systeme wie das Energie- oder das Verkehrssystem so umzustellen, dass sie nicht mehr auf fossile Energie angewiesen sind – aber möglichst, ohne dass die Nutzer:innen etwas bemerken. Ein Drittel dachte gross: Industriegesellschaft. Kapitalismus. Wirtschaftswachstum. Ungerechte Verteilung des Wohlstands. Der Rest standdazwischen: nicht gerade eine Revolution, aber doch Veränderungen der Art und Weise, wie wir uns bewegen, wie wir konsumieren, wie wir wohnen und so weiter – Veränderungen, die die Menschen spüren – und hoffentlich mögen.»
Marcel Hänggi ist Mitinitiant der Gletscher-Initiative. Anthony Patt und Julia Steinberger sind Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der Gletscher-Initiative.
«Die Lebensqualität wird oft besser, wenn der Ressourcenverbrauch sinkt»
 Foto: Thibaut Schneeberger
Foto: Thibaut Schneeberger Weil es jetzt sehr schnell gehen muss, damit wir die Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad begrenzen können. Wir müssen grundlegend anders produzieren und konsumieren. Dabei müssen sich sowohl technische wie institutionelle und kulturelle Aspekte der Wohn-, Transport- oder Ernährungssysteme verändern.
Der neue IPCC-Bericht spricht von Möglichkeiten, also Energie zu sparen; von Suffizienz – also davon, Bedürfnisse zu begrenzen, statt sie immer grösser werden zu lassen – und von Verhaltensänderungen wiebeispielsweise weniger Fleischkonsum. Sind das Beispiele für systemisch Veränderungen?
Ja, die Nachfrage verändern ist immer ein Element struktureller Transformation. Und das Gute dabei ist: Die Lebensqualität wird in vielen Fällen besser, wenn der Ressourcenverbrauch sinkt – beispielsweise, weil Menschen, die zu Fuss gehen oder Velo fahren oder weniger Fleisch essen, gesünder sind.
Ich habe den Eindruck, dass die Klimapolitik bisher eher versucht, systemische Veränderungen zu vermeiden.
Es gibt sehr verschiedene Politiken. Aber mehrheitlich stimmt schon, was Sie sagen. Gerade für die Schweiz: Auch das im letzten Juni abgelehnte CO2-Gesetz hätte nur schrittweise und ungenügende Veränderungen gebracht. Und indem die Schweiz Emissionen im Ausland «kompensiert», vermeidet sie die nötigen Strukturanpassungen. In der Schweiz wird Klimapolitik als etwas wahrgenommen, das teuer ist und weh tut. Dabei wäre die Veränderung der Struktur von Systemen ein sehr mächtiger Hebel, und eine systemische Klimapolitik hätte viele positive Nebeneffekte. Das zeigt der aktuelle IPCC-Bericht deutlich, und ich hoffe, dass er dazu beiträgt, die Wahrnehmung zu korrigieren!
Der Bundesrat baut seine Klimapolitik auf den Energieperspektiven 2050+. Bei deren Erstellung wurde bewusst entschieden, Suffizienz nicht zu berücksichtigen. Das war also ein Fehlentscheid?
Als IPCC-Autorin sage ich den Staaten nicht, was sie tun müssen. Aber der Bericht zeigt das grosse Potenzial von Suffizienz. Weltweit liessen sich bis 2050 40 bis 70 Prozent der Emissionen allein dadurch einsparen, dass man die Energienachfrage senkt.
Im Entwurf der Zusammenfassung des Berichts stand ein interessanter Satz, der in der Schlussberatung von den Mitgliedstaaten des IPCC offenbar gestrichen wurde: «Zu den Faktoren, die einen ambitionierten Wandel behindern, gehören (…) ein schrittweiser statt systemischer Ansatz (…) sowie Eigeninteressen.»
Die Schlussverhandlungen finden hinter verschlossener Tür statt und ich darf sie nicht kommentieren. Doch im 3000-seitigen Gesamtbericht, der nicht von den Regierungen abgesegnet werden muss, ist diese Aussage gut begründet.
Gibt es Länder, die anders vorgehen?
Ja, etwa Norwegen mit seiner Förderung der Elektro-Automobilität. Norwegen hat früh begonnen, E-Autos zu fördern, da konnten auch schrittweise Änderungen einen systemischen Effekt bewirken. Wenn ein Land erst jetzt damit beginnt, ist es umso wichtiger, die Mobilität umfassend zu denken: Da geht es um Raumplanung und Städtebau, um Fuss- und Veloverkehr und um institutionelle, infrastrukturelle und kulturelle Veränderungen. Der IPCC-Bericht kann dafür erfolgreiche Beispiele nennen – niederländische Städte Kopenhagen, aber auch Barcelona oder Paris haben es geschafft, einen CO2-armen städtischen Lebensstil zu etablieren, der stark auf das Velo setzt.
Sie sind Ko-Autorin der Studie «Providing decent living with minimum energy» («Mit minimalem Energieverbrauch ein würdevolles Leben ermöglichen»). Der IPCC hat den Begriff des «würdevollen Lebens» aufgenommen. Das scheint mir ein echter Paradigmenwechsel gegenüber ökonomische Kosten-Nutzen-Betrachtungen …
Ja, das ist ein grosser Kontrast auch zu letzten IPCC-Bericht von 2014! Die Forschung hat sich in diese Richtung geöffnet. Das Konzept des «würdevollen Lebens» hat vor allem Professor Narasimha Rao der Universität Yale entwickelt und in Indien, Südafrika und Brasilien angewandt. Die Reduktion der materiellen Armut und Umweltschutz wurden lange als Gegensätze betrachtet. Heute sehen wir, dass sie zusammengehören.
Und doch wollen alle das Bruttoinlandsprodukt (BIP) steigern!
Als der Ökonom Simon Kuznets den Begriff vor neunzig Jahren einführte, sagte er bereits, dass das keine Grösse sei, um das Wohlergehen der Menschen zu messen: Es misst lediglich wirtschaftliche Aktivität. Die Ökonom:innen wissen das natürlich – theoretisch. Viele Kolleg:innen, die mit dem BIP rechnen, tun das nicht, weil sie es für eine gute Grösse halten, sondern weil es die Grösse ist, die in den Modellen eingebaut ist.
Aber in der Wirtschaftspolitik bleibt das BIP-Wachstum das Mass aller Dinge.
Ja, viele Politiker:innen haben das nicht verstanden. Und man kann halt wunderbar vergleichen, wer das höhere BIP hat!
Sie definieren «System» als etwas, das aus Komponenten besteht, die miteinander wechselwirken. Das ist ja eigentlich recht banal … Warum fällt es offenbar so schwer, die globale Erwärmung systemisch wahrzunehmen und anzugehen?
In den Wissenschaften ist der Systembegriff heute gut eingeführt, aber wenn ich beim Schweizerischen Nationalfonds ein Projekt eingebe, muss ich das einer bestimmten Disziplin zuordnen. Ein systemischer Ansatz hält sich aber nicht an Disziplinengrenzen. Da täte ein Systemumbau auch Not! Und in der Politik ist das Systemdenken noch kaum verstanden.
Beispiel: System Automobilismus
All diese Systemkomponenten haben sich in den letzten gut hundert Jahren rund um die Eigenschaften des Autos mit Verbrennungsmotor entwickelt und gegenseitig verstärkt: Autos, die sehr schnell fahren können, verlangen nach bestimmten Strassen, welche dann wiederum schnelle Autos bevorzugen. Das Auto ermöglicht die Entstehung abgelegener Siedlungen, deren Bewohner:innen dann wiederum auf ein Auto angewiesen sind. Der Autoverkehr zwingt Eltern, ihre Kinder autogerecht zu erziehen, denen dann nicht mehr auffällt, was ihnen das Auto wegnimmt … und so weiter.
Versucht man jetzt, den motorisierten Individualverkehr zu elektrifizieren, indem man Autos baut, die in allen anderen Aspekten möglichst den Verbrennern ähneln – die ebenso übergewichtig, übermotorisiert und überschnell sind –, so ist das ein Schitt in die richtige Richtung. Und man könnte diesen Schritt bereits systemisch nennen, da zumindest eine zweite Systemkomponente mit geändert werden muss: die Energiebereitstellung. Aber die blosse Umstellung der Antriebstechnik bleibt doch weit zurück hinter den Möglichkeiten einer echten, systemischen Verkehrswende.
Den Fahrzeugherstellern kann man daraus keinen Vorwurf machen: Sie bauen Autos für Benutzer:innen, deren Bedürfnisse sich im existierenden System gebildet haben. Einen Systemumbau darf man nicht von Marktakteur:innen allein erwarten.