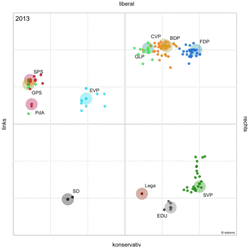 Animation: Sotomo
Animation: Sotomo Plötzlich diese Definitionsmacht. Michael Hermann ist Geograf an der Uni Zürich. Er hat mit Kollegen der Universitäten Zürich und Bern die politischen Diagramme und Ratings zur Perfektion entwickelt. Der «Tages-Anzeiger» verwendet sie, die NZZ und «Le Temps» greifen darauf zurück. PolitikerInnen von links bis rechts stellen das Spinnennetz ihres Profils auf ihre Website. Für die «NZZ am Sonntag» erkürt Hermann die liberalsten NationalrätInnen, und im «Magazin» erklärt er, dass es in der Schweiz keinen Rechtsrutsch gegeben hat.
Das wird dann als «Analyse jenseits von rechter Märchenstunde und linker Horrorshow» angepriesen. Nüchterne Fakten statt Ideologie: eine Masche, die in den Medien seit ein paar Jahren beliebt ist; eine Masche, die vor allem «Weltwoche»-Chef Roger Köppel immer wieder pflegt. Eine Ironie: denn gegen Köppel will sich Hermann absetzen. Es sei ein Ziel des Liberalitätsrankings für die «NZZ am Sonntag» gewesen, sagt er, «zu zeigen, dass ‹liberal› mehr heisst, als die ‹Weltwoche› darunter versteht: nämlich mehr als nur wirtschaftsliberal». Das Ranking misst zwei «Liberalitäten»: eine wirtschaftliche und eine gesellschaftliche; die Messung geschah durch Auszählen des Abstimmungsverhaltens im Nationalrat. Die Botschaft, die die «NZZ am Sonntag» daraus machte, lautete: «Liberalität lässt sich messen.»
Das kann man anzweifeln. Während sich «wirtschaftsliberal» einigermassen stringent als Laisser-faire-Position definieren lässt, ist das bei «gesellschaftsliberal» problematischer. Ein Fahrverbot beschneidet die Freiheit des Autofahrers und schützt die Freiheit des spielenden Kindes: Ist das nun liberal oder nicht? Die akkuraten Listen und Grafiken verbergen, dass dahinter subjektive Zuordnungen stehen: Michael Hermann entscheidet, welche Position er als liberal respektive illiberal wertet. Blind sind seine Auswertungen von Abstimmungen, wenn gegensätzliche Motive zur selben Position führen. Man konnte etwa den Beitritt zum Abkommen von Schengen aus Isolationismus ablehnen oder aus Vorbehalt gegenüber der Stärkung des (Polizei-)Staats.
Indem Hermann den gesellschafts- und den wirtschaftsliberalen Wert einfach addiert, schafft er einen hypothetischen «Gesamtliberalismus». Sieger des Ratings ist übrigens Felix Gutzwiller – also der Politiker, der im Moment vor allem mit repressiver (AntiraucherInnen-)Politik von sich reden macht. Man hätte die ganze Sache auch anders interpretieren können: Ausser bei einigen FDP-PolitikerInnen divergieren die beiden Liberalitätswerte stark, folglich gibt es gar keinen Gesamtliberalismus.
Problematisch ist auch Hermanns Aussage im «Magazin»: Dass kein Rechtsrutsch stattgefunden habe, begründet er mit der Durchsetzungskraft der Parteien. So habe die SVP in der laufenden Legislatur nur 70 Prozent der Abstimmungen gewonnen, gegenüber 73 Prozent in der vorletzten – trotz fast doppelter Sitzzahl. Nur: Wenn der FC Links zwei Drittel aller Zweikämpfe gewinnt, diese Zweikämpfe aber alle im linken Strafraum stattfinden, wird man schwerlich sagen, der FC Links dominiere das Spiel. Wichtige linke Siege an der Urne – Avanti, Steuerpaket, Strommarktliberalisierung – haben tatsächlich «im linken Strafraum» stattgefunden. Und die Grafik der Rechts-links-Verteilung im Nationalrat, welche grosse Stabilität über die drei Legislaturen suggeriert, ist blind dafür, wie sich das gesamte Koordinatensystem verschiebt.
Ist Michael Hermann ein schrecklicher Vereinfacher?
Hans Hirter, Politologe an der Uni Bern, weiss über Hermann nur Gutes zu berichten. «Anfangs begegneten wir Politologen ihm mit Skepsis, aber das legte sich schnell. Wir sahen, dass Hermann mit denselben Methoden arbeitet wie wir und dass er es seriös tut. Er stellt seine Resultate einfach anders dar. Besser.» Die schweizerische Politologie, sagt Hirter, stehe in der US-amerikanischen Tradition und sei quantitativ ausgerichtet, während die deutsche und vor allem die französische stärker geisteswissenschaftlich arbeiteten.
Das Gespräch mit Hermann ist anregend – er ist jemand, der die Schweizer Politlandschaft seit Jahren verfolgt und mehr im Kopf hat als nur Statistiken. «Man darf», betont er, «unsere Zahlen nicht verabsolutieren». Er pflichtet bei, dass beispielsweise «liberal» ein heikler Begriff sei: «Das ‹NZZ am Sonntag›-Rating war vielleicht das Subjektivste, was ich gemacht habe. Ich sehe das als Debattenbeitrag». Die Zuspitzung «Liberalität lässt sich messen» stamme nicht von ihm, sondern von der Redaktion.
Hohe Suggestivkraft
Auch räumt Hermann ein, dass sich alleine aus dem Auszählen der Abstimmungen nicht folgern lasse, ob ein Rechtsrutsch stattfinde oder nicht. In der AusländerInnen- und Asylpolitik – so schrieb Hermann auch in seinem «Magazin»-Artikel – habe sich das Koordinatensystem tatsächlich nach rechts verschoben. Dass aber die Politik insgesamt nicht nach rechts gerutscht sei, folgere er nicht einfach aus der Statistik; das beruhe auf inhaltlicher Interpretation.
Allein: Was die Medien an Hermanns Arbeit so lieben, sind nicht die differenzierten Analysen, sondern die einprägsamen Diagramme. Bilder haben in den vergangenen Jahren in Wissenschaft, Medien und vor allem im Zusammenspiel der beiden an Bedeutung gewonnen. Das liegt an neuen Möglichkeiten der computergestützten Grafik, an neuen bildgebenden Techniken wie Satelliten oder Tomografen und an der gestiegenen Erwartung an die Wissenschaft, ihre Resultate werbewirksam zu präsentieren. Selbstkritische HirnforscherInnen beispielsweise sind sich bewusst, dass die Disziplin ihren Boom zu einem guten Teil der Suggestivkraft der von ihr produzierten Bilder verdankt.
Die Geografie hatte mit der Kartografie immer schon eine grafische Subdisziplin, und diese wurde durch die satelliten- und computergestützten geografischen Informationssysteme enorm erweitert. Der Geograf Hermann und Mitstreiter wie Heiri Leuthold haben diese Fähigkeiten erfolgreich in die Politologie eingebracht.
Hermanns Diagramme sind faszinierend. Man sollte sie aber nicht, wie einige Medien das tun, zur faktengestützten Wahrheit stilisieren.
Marcel Hänggi
www.parlamentsspiegel.ch
www.sotomo.ch