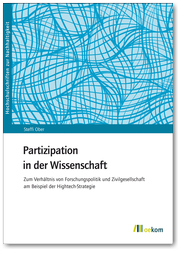| Die Debatte, die die WOZ mit der Publikation von Sponsoringverträgen zwischen der Universität Zürich und der UBS respektive zwischen der ETH Lausanne und Nestlé angestossen hat, schien sich – oberflächlich betrachtet – darum zu drehen, wie Wissenschaft von wissenschaftsfremden Einflüssen frei gehalten werden kann. Doch die «reine» Wissenschaft hat es nie gegeben, und sie wäre auch gar nicht wünschbar: Wissenschaft findet in der Gesellschaft statt und trägt dazu bei, gesellschaftliche Probleme zu lösen – oder zu verschärfen. |
Einen Teil dieser Lücke füllt nun eine Studie von Steffi Ober, der Koordinatorin der zivilgesellschaftlichen Plattform Forschungswende. Ober hat sich die «Hightech-Strategie» (HTS) vorgenommen, eine Forschungsförderungsstrategie der deutschen Bundesregierung, die auf die Regierung von Gerhard Schröder (SPD) zurückgeht und unter Angela Merkel (CDU) eine besondere Nähe zum Kanzleramt geniesst. Im Rahmen der HTS denken ExpertInnengremien eine Forschungspolitik vor, die zu «nachhaltigen» Lösungen der «grossen Herausforderungen» der Gegenwart vom Klimawandel über die Energieversorgung bis zur Sicherheit beitragen soll. Ihre Empfehlungen werden ohne grosse Mitwirkung des Parlaments vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in konkrete Förderpolitik umgesetzt. Und die HTS gilt als Vorbild für das EU-Forschungsrahmenprogramm «Horizont 2020».
Ober hat sich angeschaut, wer in den Gremien sitzt, sie hat Protokolle studiert und Interviews geführt. Ihre Resultate sind erschreckend: Ober selbst sagt gegenüber der WOZ, so viel institutionalisierte Nähe zwischen der Forschungsförderung des Bundes und der Industrie hätte sie nicht erwartet. Die ExpertInnen der Hightechstrategie sind fast ausschliesslich Experten; Frauen fehlen fast ganz. Die Experten vertreten vor allem die Technik- und Naturwissenschaften; Sozial- und Geisteswissenschaften sind kaum dabei. Und sie vertreten hauptsächlich Grossunternehmen und insbesondere die Automobilindustrie: KMU können es sich gar nicht leisten, ExpertInnen für diese Arbeit freizustellen. Vor allem aber fehlen zivilgesellschaftliche Organisationen. Und wenn die HTS «Bürgerdialoge» veranstaltet, geht es nicht wirklich um eine ergebnisoffene Diskussion, sondern um Akzeptanzbeschaffung.
Bei dieser Zusammensetzung erstaunt nicht, dass Problemlösung für die HTS vor allem Unterstützung bei der Produktentwicklung bedeutet. Der gesellschaftliche Kontext interessiert nicht. Das Denken ist von Managementlogik geprägt. Von «Nachhaltigkeit» ist oft die Rede – aber gemeint ist damit «nachhaltiges (Wirtschafts-)Wachstum». Wachstumskritische Positionen tauchen nicht auf, obwohl der Deutsche Bundestag dazu eine Enquetekommission eingesetzt hat. Kritische Selbstreflexion findet nicht statt. «Kontroversen», schreibt Ober, «scheint es in den recht homogenen Teilnehmerkreisen nicht gegeben zu haben.»
Im Vergleich dazu nimmt sich die Situation in der Schweiz geradezu idyllisch aus. Die Forschungsförderung ist hierzulande anders organisiert; eine derartige institutionalisierte Nähe zu den Grossunternehmen gibt es nicht (wenn man auch die informelle Verfilzung nicht unterschätzen darf). Zwar denken auch hierzulande Leute wie ETH-Lausanne-Präsident Patrick Aebischer, wer mehr Steuern zahlt, solle auch stärker mitbestimmen dürfen, was geforscht wird. Doch immerhin lösen solche plumpen Aussagen kontroverse öffentliche Debatten aus. In einer Welt der globalisierten Forschung strahlt die Forschungspolitik des Nachbarlands aber natürlich auch in die Schweiz aus.
Steffi Obers Studie ist kein Lesevergnügen, sie hätte ein Lektorat gebraucht, und manchmal wünschte man sich etwas mehr Tiefe. Aber endlich hat mal jemand genau hingeschaut.
Marcel Hänggi