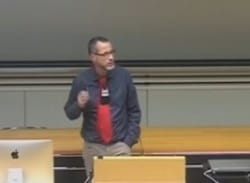Leitfaden Vortragen
In den letzten Jahren habe ich einen Teil meines Lebensunterhalts mit Vorträgen verdient, vom 7-minütigen Input bis zum 50-minütigen Referat mit anschließender Diskussion. Und ich habe viele Vorträge gehört, brillante und sterbenslangweilige.
Dieser Leitfaden soll helfen, Referate (fast) egal welcher Länge vorzubreiten und zu halten.
Dieser Leitfaden soll helfen, Referate (fast) egal welcher Länge vorzubreiten und zu halten.
Einleitung
Die kürzeste Vortragsanweisung, die ich kenne, stammt von Martin Luther:
Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf.
Dieser Leitfaden befasst sich
Die klassische Rhetorik kennt von Vorbereitung bis Auftritt fünf Schritte:
(Wichtig: Die fünf Schritte der klassischen Rhetoriklehre sind keinesfalls als lineare Abfolge zu absolvieren –
kreative Prozesse laufen nicht so ab, dass man brav eins nach dem anderen tut.)
1. Tritt fest auf (actio)
Hier geht es um eine Äußerlichkeit, aber:
für die Wirkung des Vortrags ist die sehr wichtig.
Luthers Anweisung dreht sich zu zwei Dritteln um «Äußerlichkeiten», um den Auftritt (actio) und das Sprechen (pronunciatio)!
Den ersten Eindruck vermittelt die Kleidung.
Kleidung soll angemessen sein (das heißt aber nicht, dass ich bei einem Vortrag vor Vorstandsvorsitzenden Nadelstreifen trüge: Ich will nicht so tun, als sei ich einer von ihnen).
Mit Dresscodes kann man auch ein wenig spielen (zum Vortrag an einer Uni, wo niemand Krawatte trägt, binde ich mir unter Umständen eine um).
Nach der Kleidung folgt die Körperhaltung / Körpersprache.
Solange ich nicht nervös wirke:
Ob ich fest da stehe, mich lässig an eine Tischkante anlehne oder mich auf Pult aufstütze, ist nebensächlich.
(Auch wenn jetzt alle Kommunikationstrainer aufschreien:
mich stören nicht einmal Hände in der Hosentache –
wenn diese Haltung nicht Desinteresse signalisiert, sondern als ein Understatement eingesetzt wird):
Wichtig ist die Haltung, die ich ausdrücke.
Nämlich:
Sind sie erfüllt: Dann bitte entsprechend auftreten!
Schließlich, ganz wichtig:
Der Blick gehört ins Publikum und weder auf ein Skript noch auf einen Bildschirm noch gar auf die Leinwand hinter mir.
So sehe ich auch, ob meine Botschaften ankommen. (Es sei denn, man müsse gegen einen überhellen Scheinwerfer sprechen. Das ist scheiße.)
2. Mach's Maul auf (pronuntiatio)
Überflüssig zu sagen: deutlich und laut genug sprechen!
Aber wie schnell?
Langsamer ist leichter verständlich; schneller verträgt weniger Fehler, weniger Äh und Öh.
Deshalb, wer auf Nummer sicher gehen will: lieber langsam sprechen.
Aber: Ich habe brillante rasend schnelle Vorträge gehört und einschläfernde langsame.
Schnell sprechen mit Pausen ist oft besser als langsam sprechen ohne Pausen.
Ein hohes Tempo kann ein rhetorisches Mittel sein (gerade in einer Gegenrede spreche ich unter Umständen gern sehr schnell).
Das Maulaufmachen ist das Medium des Vortrags!
Zusätzliche Medien wie Powerpoint sollen unterstützen, dürfen aber nur Nebenmedium sein.
Die meisten Powerpoint-Präsentationen, die ich sah, lenkten nur ab.
Präsentationen sind (nur) gut für: Bilder und Grafiken, Aufzählungen (in kurzen Stichworten!), wichtige Zitate.
Wenige Slides, kein Schnickschnack.
Nie Text zeigen und gleichzeitig sprechen. Zeigt man Text, braucht das Publikum Zeit, ihn zu lesen!
Und wenn es nichts zu zeigen gibt, kann man auch ganz ohne Präsentation sprechen.
3. Hör bald auf (dispositio und elocutio)
Meine Erfahrung: für einen Vortrag sind 45 Minuten das Maximum.
Nur wenige Leute sprechen so gut, dass man ihnen auch länger gern zuhört.
Aber egal, wie lang der Vortrag: Das Publikum darf sich nicht langweilen. Dazu braucht es:
4. Vortragsvorbereitung (inventio, memoria)
Ich bereite Vorträge stets schriftlich vor (tu ich's nur im Kopf, kommt's nicht gut):
nicht in ganzen Sätzen vollkommen ausformuliert, aber doch in detaillierten Stichworten.
Dann lese ich meinen Vortrag wie einen Fremdtext und markiere die Schlüsselwörter.
Auswendiglernen geht gut beim Joggen, Spazieren…
Die Schlüsselwörter notiere ich auf einen Zettel, den ich am Vortrag dabei habe – als Notnagel, falls ich den Faden verliere (sowie für Zitate und allenfalls für Aufzählungen).
Wenn ich den Faden verliere, fällt mir kein Stein aus der Krone, wenn ich um ein paar Sekunden Pause bitte, den Zettel hervorkrame, drauf schaue, den Zettel wieder wegstecke – und dann weiterrede.
Und zum Schluss…
Ein guter Vortrag braucht auch einen guten Schluss.
Hier will ich, nachdem von der klassischen Rhetorik und von Luther schon die Rede war, mit mittelalterlicher Gelehrsamkeit enden.
Das (hoch-)mittelalterliche Universitätsstudium bestand aus sieben Fächern.
Die vier Fächer der Oberstufe (Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) hießen Quadrivium; sie bauten auf den drei Fächern der Unterstufe, dem Trivium, auf: Grammatik, Dialektik, Rhetorik.
Was zum Trivium gehört, nennt man trivial –
Keine Furcht deshalb vor dem freien Sprechen: Es ist trivial!
Die kürzeste Vortragsanweisung, die ich kenne, stammt von Martin Luther:
Tritt fest auf, mach’s Maul auf, hör bald auf.
Dieser Leitfaden befasst sich
- zuerst mit dem festen Auftreten;
- dann mit dem Maulaufmachen;
- drittens weniger mit dem baldigen Aufhören als mit der Frage: Wie ist Vortrag zu gestalten, damit Zuhörer/innen das Aufhören als ein baldiges empfinden;
- viertens mit der Vorbereitung.
Die klassische Rhetorik kennt von Vorbereitung bis Auftritt fünf Schritte:
- inventio: das Finden der Argumente;
- dispositio: die Gliederung des Vortrags. Ich spreche lieber von «Dramaturgie»;
- elocutio: die Ausformulierung;
- memoria: das Auswendiglernen;
- actio / pronuntiatio: der Auftritt.
(Wichtig: Die fünf Schritte der klassischen Rhetoriklehre sind keinesfalls als lineare Abfolge zu absolvieren –
kreative Prozesse laufen nicht so ab, dass man brav eins nach dem anderen tut.)
1. Tritt fest auf (actio)
Hier geht es um eine Äußerlichkeit, aber:
für die Wirkung des Vortrags ist die sehr wichtig.
Luthers Anweisung dreht sich zu zwei Dritteln um «Äußerlichkeiten», um den Auftritt (actio) und das Sprechen (pronunciatio)!
Den ersten Eindruck vermittelt die Kleidung.
Kleidung soll angemessen sein (das heißt aber nicht, dass ich bei einem Vortrag vor Vorstandsvorsitzenden Nadelstreifen trüge: Ich will nicht so tun, als sei ich einer von ihnen).
Mit Dresscodes kann man auch ein wenig spielen (zum Vortrag an einer Uni, wo niemand Krawatte trägt, binde ich mir unter Umständen eine um).
Nach der Kleidung folgt die Körperhaltung / Körpersprache.
Solange ich nicht nervös wirke:
Ob ich fest da stehe, mich lässig an eine Tischkante anlehne oder mich auf Pult aufstütze, ist nebensächlich.
(Auch wenn jetzt alle Kommunikationstrainer aufschreien:
mich stören nicht einmal Hände in der Hosentache –
wenn diese Haltung nicht Desinteresse signalisiert, sondern als ein Understatement eingesetzt wird):
Wichtig ist die Haltung, die ich ausdrücke.
Nämlich:
- Ich habe etwas mitzuteilen, das es Wert ist, mir bis am Ende zuzuhören.
- Ich teile das so mit, dass alle gern zuhören.
- Es macht mir selber Spaß.
Sind sie erfüllt: Dann bitte entsprechend auftreten!
Schließlich, ganz wichtig:
Der Blick gehört ins Publikum und weder auf ein Skript noch auf einen Bildschirm noch gar auf die Leinwand hinter mir.
So sehe ich auch, ob meine Botschaften ankommen. (Es sei denn, man müsse gegen einen überhellen Scheinwerfer sprechen. Das ist scheiße.)
2. Mach's Maul auf (pronuntiatio)
Überflüssig zu sagen: deutlich und laut genug sprechen!
Aber wie schnell?
Langsamer ist leichter verständlich; schneller verträgt weniger Fehler, weniger Äh und Öh.
Deshalb, wer auf Nummer sicher gehen will: lieber langsam sprechen.
Aber: Ich habe brillante rasend schnelle Vorträge gehört und einschläfernde langsame.
Schnell sprechen mit Pausen ist oft besser als langsam sprechen ohne Pausen.
Ein hohes Tempo kann ein rhetorisches Mittel sein (gerade in einer Gegenrede spreche ich unter Umständen gern sehr schnell).
Das Maulaufmachen ist das Medium des Vortrags!
Zusätzliche Medien wie Powerpoint sollen unterstützen, dürfen aber nur Nebenmedium sein.
Die meisten Powerpoint-Präsentationen, die ich sah, lenkten nur ab.
Präsentationen sind (nur) gut für: Bilder und Grafiken, Aufzählungen (in kurzen Stichworten!), wichtige Zitate.
Wenige Slides, kein Schnickschnack.
Nie Text zeigen und gleichzeitig sprechen. Zeigt man Text, braucht das Publikum Zeit, ihn zu lesen!
Und wenn es nichts zu zeigen gibt, kann man auch ganz ohne Präsentation sprechen.
3. Hör bald auf (dispositio und elocutio)
Meine Erfahrung: für einen Vortrag sind 45 Minuten das Maximum.
Nur wenige Leute sprechen so gut, dass man ihnen auch länger gern zuhört.
Aber egal, wie lang der Vortrag: Das Publikum darf sich nicht langweilen. Dazu braucht es:
- Anpassung ans Publikum: Wer sind meine Zuhörer/innen, was ist ihr Vorwissen, was wollen sie hören? Was muss ich ihnen erklären, was wissen sie selber schon?
- eine klare Dramaturgie
- packender Einstieg, pointierter Schluss, klarer roter Faden (wie Luthers Zitat in diesem Leitfaden), Spannungsbögen
- klare Sprache
- mündliche Sprache ist etwas anderes als schriftliche Sprache!
- keine Schachtelsätze, Nominalphrasen, Füllwörter, Passivsätze… (lieber auch nicht in der schriftlichen Sprache; in einem Vortrag auf keinen Fall)
- wenig Adjektive, viele flektierte Verben
- kein name dropping, keine Phrasen, keine abgegriffenen Sprichwörter / Redewendungen (wie: «Das ist nur die Spitze des Eisbergs»)
- kein «Wie Sie wissen», kein «bekanntlich» (vielleicht wissen es die Zuhörer ja nicht, und wenn sie's wissen, wissen sie, dass sie's wissen)
- Geschichten und Anekdoten erzählen; Theoretisches an konkreten Beispielen erläutern
- Witze, Überraschungen, rhetorische Figuren wie Paradoxa
- Es gibt Leute mit komischem Talent, bei denen lacht man vom Anfang bis am Ende. Das ist großartig – aber die wenigsten können das. Also nicht übertreiben! Ein oder zwei Witze sollten aber schon drinliegen.
- Wechselnde Distanz statt stets Halbtotale
- Man kann sowohl aus der Totale ins Detail zoomen wie umgekehrt, aber meist besser: vom Speziellen zum Allgemeinen (in der Sprache der Logik: induktiv statt deduktiv)
- Meta-Bemerkungen (nur) dann, wenn sie helfen, die Gliederung des Vortrags sichtbar zu machen: «Ich fasse zusammen»; «Ich mache jetzt einen Sprung»; «Wie wir gesehen haben»; «Ich komme darauf zurück».
- Flexibilität: Den Vortrag je nach Vorredner, aktuellen Tagesereignissen und Reaktionen aus dem Publikum anpassen!
- Ich habe schon aufgrund eines Vorredners meine ganze Vortragsplanung über den Haufen geworfen und frei improvisiert – das waren nicht die schlechtesten Vorträge.
- Manchmal nehme ich vorweg, was (aufgrund des Programms) jemand anderes nach mir sagen wird. Nimmt dieser Nachredner dann nicht seinerseits auf mich Bezug, wirkt er unsouverän – aber das ist dann seine Sache.
- frei sprechen! unbedingt!!
- Ausnahme: Zitate ablesen. Mit dem Ablesen markiere ich auch: Achtung, andere Textsorte!
- Bei Aufzählungen nehme ich Notizen zu Hilfe, um nichts zu vergessen.
- Warum ist das freie Sprechen so wichtig?
Der Blick gehört ins Publikum, nicht auf ein Blatt Papier;
das Memorieren zwingt mich zu einem klaren Aufbau mit einem deutlichen roten Faden;
frei formuliere ich mündliche Sprache, statt schriftliche Sprache abzulesen;
ich bin frei, den Vortrag spontan äußeren Gegebenheiten anzupassen.)
4. Vortragsvorbereitung (inventio, memoria)
Ich bereite Vorträge stets schriftlich vor (tu ich's nur im Kopf, kommt's nicht gut):
nicht in ganzen Sätzen vollkommen ausformuliert, aber doch in detaillierten Stichworten.
Dann lese ich meinen Vortrag wie einen Fremdtext und markiere die Schlüsselwörter.
Auswendiglernen geht gut beim Joggen, Spazieren…
Die Schlüsselwörter notiere ich auf einen Zettel, den ich am Vortrag dabei habe – als Notnagel, falls ich den Faden verliere (sowie für Zitate und allenfalls für Aufzählungen).
Wenn ich den Faden verliere, fällt mir kein Stein aus der Krone, wenn ich um ein paar Sekunden Pause bitte, den Zettel hervorkrame, drauf schaue, den Zettel wieder wegstecke – und dann weiterrede.
Und zum Schluss…
Ein guter Vortrag braucht auch einen guten Schluss.
Hier will ich, nachdem von der klassischen Rhetorik und von Luther schon die Rede war, mit mittelalterlicher Gelehrsamkeit enden.
Das (hoch-)mittelalterliche Universitätsstudium bestand aus sieben Fächern.
Die vier Fächer der Oberstufe (Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie) hießen Quadrivium; sie bauten auf den drei Fächern der Unterstufe, dem Trivium, auf: Grammatik, Dialektik, Rhetorik.
Was zum Trivium gehört, nennt man trivial –
Keine Furcht deshalb vor dem freien Sprechen: Es ist trivial!
|
(Eine Probe aufs Exempel, ob ich mich selber an den Leitfaden halte?
Hier mein Auftritt vom 1. Dezember 2016 an der Uni Zürich.) |